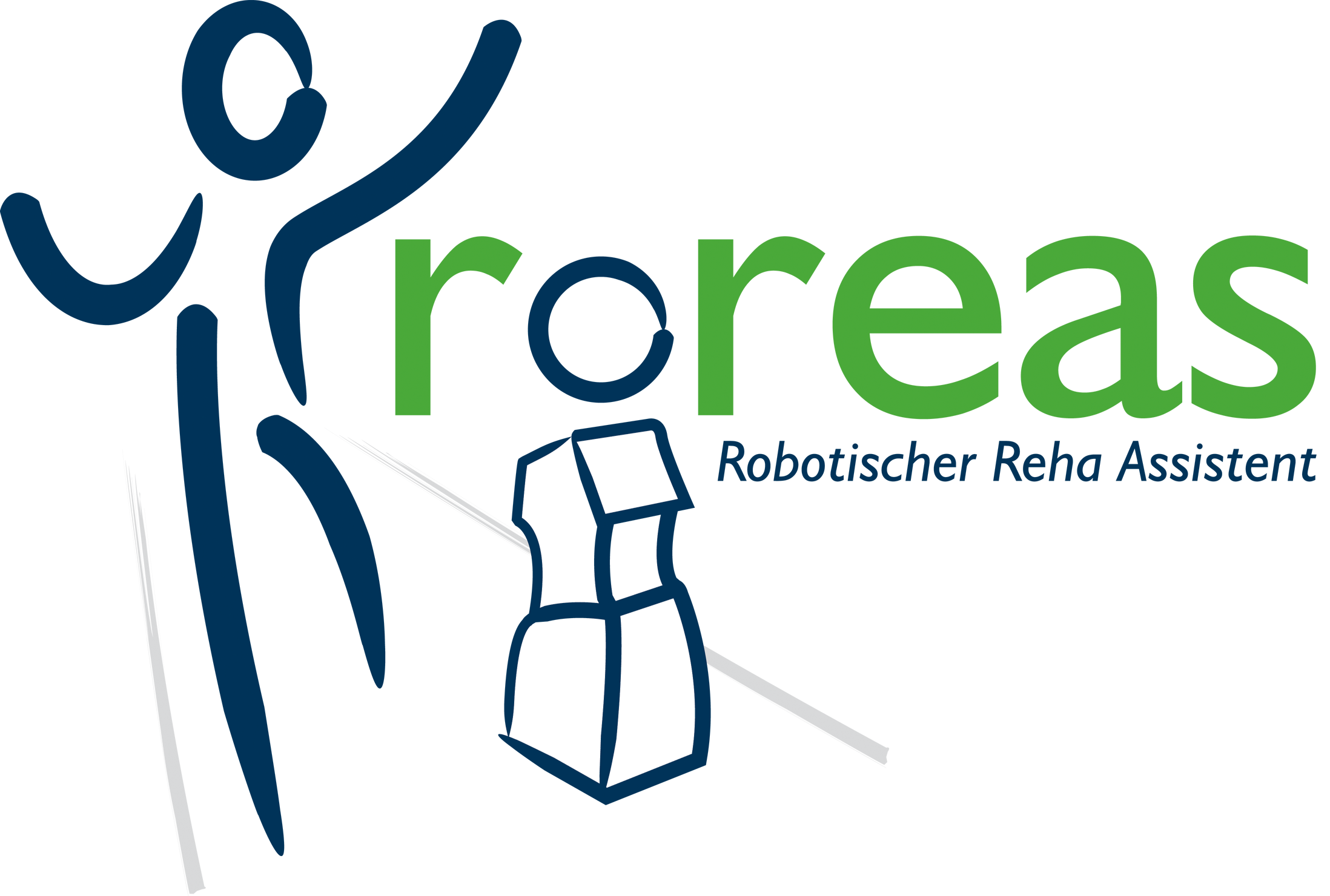Fragen und Antworten zum ROREAS-Forschungsstand
Stand: 22.10.14 (1.-9.) / 01.2017 (10.-14.)
1. Wurde der Roboter-Assistent bereits in der Praxis mit Betroffenen getestet? Wenn ja, wie haben diese reagiert? Wenn nicht, wann wird es voraussichtlich soweit sein?
- Im Projekt ROREAS (siehe auch www.roreas.org) werden zwei unterschiedliche Roboter genutzt. Gegenwärtig wird noch die Forschungsplattform Cora für erste Forschungsaufgaben genutzt, so lange bis der erste Prototyp eines im Rahmen von ROREAS speziell entwickelten Roboters zur Verfügung steht. Dessen Hardware, Sensorik und Aktuatorik ist dann direkt an die Aufgaben in ROREAS angepasst. Die Entwicklung dieses Roboters erfolgt über die Ilmenauer Firma MetraLabs GmbH, die Fertigstellung des ersten Prototypens ist für Ende 2014 geplant.
- Erst mit diesem neuen Roboter sollen dann Funktions- und Nutzertests des gesamten Systems unter Einbindung von Patienten erfolgen.
- Mit der Forschungsplattform Cora werden bereits jetzt schon, als Voraussetzung für diese Nutzertests, methodische Teilleistungen sowohl im Forschungslabor als auch in der Klinik untersucht, wie z.B. die autonome und sichere Navigation in der Klinik, die robuste Erkennung von Personen wie auch die Unterscheidung aktuellen Patienten von allen anderen erfassten Personen.
- Cora begegnet während der Funktionstest in der Klinik natürlich auch häufig Patienten, die fast alle von der neuen Robotertechnik begeistert sind, viele Fragen haben und auch mal einzelne Funktionen von sich aus ausprobieren wollen, wie z.B.: Kann der wirklich hinter mir herfahren? Insgesamt steht der Großteil der Patienten, mit denen wir in der Klinik Kontakt hatten, einem solchen Roboter-Assistenten positiv gegenüber. Wie die Akzeptanz im tatsächlichen Einsatz sein wird, wird erst in den 2015 durchzuführenden Nutzertest ermittelt werden können.
2. Was genau ist die Aufgabe des Roboter-Assistenten?
- In ROREAS soll ein robotischer Reha-Assistent für das Lauf- und Orientierungstraining in der klinischen Schlaganfallnachsorge entwickelt werden, der das häufig noch ungenutzte Potenzial des Eigentrainings im Rahmen der Neurorehabilitation besser erschließt. Als mobiler interaktiver Laufcoach soll er Schlaganfallpatienten bei Laufübungen in der Klinik begleiten, um so die Mobilität der Patienten und gleichzeitig auch deren räumliches Orientierungsvermögen zu trainieren. Dabei soll er die Durchführung der Laufübungen beobachten und das Training in auswertbarer Weise dokumentieren.
3. Wie muss ich mir den Einsatz konkret vorstellen? Wie sieht eine Therapiestunde mit “Cora” aus?
- Prinzipiell bestehen zwei Möglichkeiten des Beginns einer Nutzung des Roboter-Assistenten. Entweder ist er als Trainingseinheit im Therapieplan eines Patienten vorgesehen oder der Patient selbst kann den Roboter selbst, zu einer von ihm gewünschten Zeit, eben auch abends oder am Wochenende, zu sich an sein Zimmer, z.B. über das Zimmertelefon rufen.
- Die konkreten Abläufe einer Trainingseinheit werden gegenwärtig noch durch die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein entwickelt.
- In beiden Fällen beginnt das Training an der Zimmertür des Patienten.
- Zu Beginn des Trainings kann der Patient am Roboter dann einen vom Therapeuten patientenspezifisch vorgegebenen Weg auswählen oder in einem alternativen eher explorierenden Trainingsmodus auch seinen Weg frei durch die Klinik wählen. Der Patient läuft los und der Roboter folgt dem Patienten. Dabei wird durch den Roboter-Assistenten darauf geachtet, dass der Patient sich nicht verläuft, und er weist den Patienten ggf. auf den richtigen Weg hin. Auf dem Weg wird der Patient auch auf mögliche Ruhepunkte, z.B. Sitzgruppen, hingewiesen und an ausreichende Pausen erinnert. Darüber hinaus wurden (bzw. werden noch) in der Klinik Orientierungspunkte ermittelt, deren Kenntnis wichtig für ein räumliches Orientierungsvermögen der Patienten sind. Beim gemeinsamen Annähern von Patient und Roboter-Assistent an eine solche Position wird der Patient auf diesen Orientierungspunkt hingewiesen und ggf. auch ein kleines Orientierungsstraining durchgeführt.
- Das Training endet wieder an der Zimmertür des Patienten.
4. Wie klingt die Stimme des Roboter-Assistenten (ggf. vergleichbar mit der eines Navigationsgerätes)?
- Bislang wurde noch nicht entschieden, ob der Roboter-Assistent eine männliche oder weibliche Stimme erhalten wird. Beide Stimmen sind prinzipiell möglich, in einer gut verständlichen Qualität, mit der von Navigationsgeräten vergleichbar.
5. Wie reagiert “Cora”, wenn ein/e Patient/in Schwierigkeiten mit dem Training hat, evtl. sogar stürzt?
- Eine zu erwartende Schwierigkeit könnte z.B. sein, dass sich der Patient verläuft. Der Roboter kennt sowohl jederzeit die gemeinsame Position im Gebäude und kann auch den Patienten auf ein mögliches falsches Abbiegen hinweisen.
- Im ROREAS-Projekt direkt wird der Roboter-Assistent zunächst nicht mit der Fähigkeit der Erkennung von Stürzen ausgestattet werden. Untersuchungen zu dieser Thematik erfolgen durch unser Fachgebiet in parallel laufenden Projekten, wie z.B. SERROGA (SERvice-RObotik für die GesundheitsAssistenz, siehe auch www.serroga.de).
- Die Integration entsprechender Methoden in ROREAS könnte jedoch Inhalt von Folgeprojekten sein.
- Darüber hinaus verfügt der Roboter über die Möglichkeit der Videotelefonie, so dass während einer Trainingseinheit entweder durch den Patienten selbst oder durch den Roboter auch Hilfe von den Schwestern angefordert werden kann.
6. Ist grundsätzlich jede/r Schlaganfallpatient/in für diese Therapieform geeignet?
- Dieser Aspekt wird aktuell noch durch die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein untersucht. Prinzipiell jedoch müssen die Patienten erst von einem Therapeuten die Freigabe zum Gehen mit Rollator erhalten haben.
7. Ein Blick in die Zukunft: Wann werden wie viele Roboter-Assistenten wo im Einsatz sein?
- Eine solche Aussage ist schwer abschätzbar und bedarf auch der Auswertung der Ergebnisse des ROREAS-Projekts hinsichtlich seiner medizinischen Wirksamkeit, die vielleicht mit Ende des Projekts, Ende 2015, vorliegen werden.
- Ebenso wichtig für das Gelingen des Projektes ist die Beteiligung der Barmer GEK in ROREAS als assoziierter Projektpartner. Die Barmer GEK wird das Projekt aus Patientensicht begleiten und Chancen und Risiken der Überführung des Projekts in die Praxis kritisch hinterfragen.
- Prinzipielle Einsatzbereiche sind stationäre Einrichtungen der Rehabilitation aber auch darüber hinaus die Fortführung von Bewegungsprogrammen mit solchen Roboter-Assistenten im häuslichen Umfeld. Einen solchen Einsatz untersuchen wir (TU Ilmenau, Fachgebiet Neuroinformatik & Kognitive Robotik) auch im Rahmen des Projekts SERROGA (SERvice-RObotik für die GesundheitsAssistenz, siehe auch www.serroga.de) in Zusammenarbeit mit Senioren der AWO Thüringen.
8. Zusammenfassend: Worin liegen aus Ihrer Sicht die konkreten Vorteile einer solchen Therapie?
- Zur Beantwortung dieser Frage zitiere ich am besten CA Prof. Pfeiffer vom Projektpartner m&i-Fachklinik Bad Liebenstein mit einem Ausschnitt aus dem Projektantrag:
„Aus neurorehabilitativer Sicht ist ein wichtiges Projektziel die Entwicklung roboterassistierter Eigenübungsprogramme, bei denen robotertypische therapeutische Tugenden zum Tragen kommen können: große Geduld, hohe Übungsintensität und saubere, motivierende Erfolgsprotokollierung. Besonders attraktiv ist der Robotereinsatz für Therapieziele, bei denen eine hohe Trainingsintensität nachgewiesen nützlich, aber angesichts der knappen Personalressourcen im Routineeinsatz nicht durchführbar ist, so dass nur ein Eigentraining zielführend ist. Ziel ist hierbei der Nachweis der These, dass gehbehinderte Patienten, die den Reha-Assistenten im Eigentraining nutzen, deutlich häufiger selbständig Gehübungen machen, sobald aus therapeutischer Sicht ein sicheres Gehen mit Hilfsmittel ohne Kontakthilfe möglich ist. Ein solches Eigentraining ist im Prinzip auch ohne Roboterunterstützung möglich, scheitert aber an Ängsten vor der Selbstüberforderung („Komme ich sicher wieder zurück?“ „Kann ich das?“, „Verlaufe ich mich vielleicht im Gebäude?“).“
9. Was antworten Sie Kritikern, die im Einsatz von Robotern eine Entmenschlichung der Medizin sehen?
- Der Roboter wird im Endeffekt ein weiteres Arbeitsmittel für die Therapeuten im Rehabilitationsprozess sein und soll helfen, die Qualität medizinischer Behandlungen weiter zu steigern.
- Dabei soll mit ROREAS eine ganz neue und ergänzende Therapieform entwickelt werden, die bestehende Behandlungen nicht ablöst, sondern vielmehr als zusätzliche Leistung ergänzt.
- Wichtig ist, dass schon beim Design solcher Roboter berücksichtigt wird, dass der Umgang mit dem Roboter für den Patienten einfach sein muss und eine Interaktion mit Spaß macht, so dass der Patient selbst den Vorteil der Nutzung eines solchen technischen Systems erleben kann.
10. Seit einigen Jahren arbeiten Universitäten und spezialisierte Unternehmen mit Hochdruck an Robotern, die in der (Alten-)Pflege zum Einsatz kommen sollen. Die Barmer begleitet Innovationen wie den Reha-Roboter „Roreas“, den die MetraLabs gemeinsam mit der TU Ilmenau entwickelt. Welchen Beitrag leisten Sie konkret, um das Projekt zielführend umzusetzen?
- Die BARMER begleitet das Projekt seit Beginn sehr eng und bringt in das Projekt die Perspektive der Versicherten einer großen, bundesweit präsenten Krankenversicherung mit viel Erfahrung bei der Projektentwicklung mit ein. Denn unser Ziel ist es, wenn wir innovative Projekte unterstützen, diese wenn möglich auch in der Regelversorgung einzuführen und die medizinische Versorgung voranzutreiben. Dazu sind wir auch mit weiteren Partnern im Gespräch. Ziel ist es, Reha-Roboter perspektivisch bundesweit in Reha-Kliniken einsetzen zu können.
11. Was verspricht sich die Barmer vom Einsatz dieses oder ähnlicher Roboter? Wie profitieren die Patienten davon?
- In bestimmten Bereichen birgt die Robotik großes Potenzial. Weil beispielsweise Schlaganfälle einer langwierigen und aufwändigen Reha bedürfen, unterstützt die BARMER das Projekt ROREAS. Roreas kann die Reha nach einem Schlaganfall therapeutisch ergänzen und entscheidend beschleunigen. Wir wollen, dass Patienten so schnell wie möglich wieder zurück in den Alltag finden. Wir begleiten Innovationen wie Roreas, damit sie bereits im Entwicklungsstadium am Bedarf der Patienten ausgerichtet werden und schließlich auch in der realen Versorgung ankommen.
12. Löst der Einsatz von Robotern das Problem des Mangels an Pflegepersonal? Würde die neue Technologie die Kassen entlasten? Roboter sind teuer.
- Roreas soll Therapeuten nicht überflüssig machen, sondern den Patienten beim Eigentraining helfen. Beispielsweise führt der Roboter Buch über die kleinen Erfolge und kann das Tempo der Rehabilitation entsprechend steigern. Dafür nimmt er sich immer die nötige Zeit. Das ist in einem eng gestrickten Therapieplan ein großer Vorteil. Insofern dient der Roboter der Entlastung des Personals, kann es aber nicht ersetzen. Wenn dadurch die Reha beschleunigt wird, ist sowohl dem Patienten als auch seiner Krankenversicherung gedient. Dennoch ist kaum damit zu rechnen, dass Roboter in den nächsten Jahren flächendeckend einsatzbereit sind – dafür ist die Technologie noch nicht genug fortgeschritten. Es ist zudem analog zu der Entwicklung anderer Technologien damit zu rechnen, dass die Kosten mit der Zeit sinken. Ob und welche Leistungen dann in den gesetzlichen Regelleistungskatalog übernommen werden, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.
13. Ist es überhaupt realistisch, dass das Gesundheitssystem den Einsatz der neuen Technologie in absehbarer Zeit großflächig tragen kann?
- Was heißt, in absehbarer Zeit? Bereits heute können sich laut einer aktuellen Forsa-Umfrage 83 Prozent aller Deutschen vorstellen, im Alter einen Service-Roboter zu nutzen. Drei von vier Befragten sind überzeugt, dass Roboter eine wichtige Rolle in der Pflege übernehmen werden. Dies wird sicherlich nicht von heute auf morgen geschehen. Doch die Digitalisierung und der technologische Fortschritt werden perspektivisch in alle Lebensbereiche vordringen.
14. Gibt es bereits Roboter-Leistungen in der Pflege oder der Reha, die die Krankenkasse übernimmt?
- Roboter sind derzeit kein anerkanntes Hilfsmittel in der Pflege (stationär), so dass es keine Finanzierungsgrundlage für die GKV gibt.